
Dispersionsphaseneigenschaften und Beispiele
Das dispergierte Phase Es ist dasjenige in einem kleineren Anteil, diskontinuierlich, und es besteht aus Aggregaten sehr kleiner Teilchen in einer Dispersion. Die am häufigsten vorkommende und kontinuierlichste Phase, in der die kolloidalen Partikel liegen, wird als Dispersionsphase bezeichnet..
Dispersionen werden nach der Größe der Partikel klassifiziert, aus denen die dispergierte Phase besteht, und drei Arten von Dispersionen können unterschieden werden: grobe Dispersionen, kolloidale Lösungen und echte Lösungen..
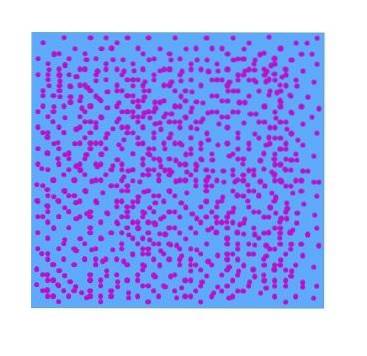
Im obigen Bild ist eine hypothetische dispergierte Phase von Purpurpartikeln in Wasser zu sehen. Infolgedessen zeigt ein mit dieser Dispersion gefülltes Glas keine Transparenz für sichtbares Licht; Das heißt, es sieht genauso aus wie ein lila flüssiger Joghurt. Die Art der Dispersionen variiert in Abhängigkeit von der Größe dieser Partikel.
Wenn sie "groß" sind (10-7 m) wir sprechen von groben Dispersionen, die sich durch Einwirkung der Schwerkraft sedimentieren können; kolloidale Lösungen, wenn ihre Größen zwischen 10 liegen-9 m und 10-6 m, wodurch sie nur mit einem Ultramikroskop oder Elektronenmikroskop sichtbar werden; und echte Lösungen, wenn ihre Größen weniger als 10 sind-9 m, in der Lage zu sein, Membranen zu kreuzen.
Die wahren Lösungen sind daher alle im Volksmund bekannten, wie Essig oder Zuckerwasser.
Artikelverzeichnis
- 1 Eigenschaften der dispergierten Phase
- 1.1 Brownsche Bewegung und der Tyndall-Effekt
- 1.2 Heterogenität
- 1.3 Stabilität
- 2 Beispiele
- 2.1 Feste Lösungen
- 2.2 Feste Emulsionen
- 2.3 Feste Schäume
- 2.4 Sonnen und Gele
- 2.5 Emulsionen
- 2.6 Schäume
- 2.7 Feste Aerosole
- 2.8 Flüssige Aerosole
- 2.9 Wahre Lösungen
- 3 Referenzen
Eigenschaften der dispergierten Phase
Die Lösungen stellen einen besonderen Fall der Dispersionen dar, da diese für die Kenntnis der Physiochemie der Lebewesen von großem Interesse sind. Die meisten biologischen Substanzen, sowohl intrazellulär als auch extrazellulär, liegen in Form von sogenannten Dispersionen vor.
Brownsche Bewegung und der Tyndall-Effekt
Die Partikel der dispergierten Phase kolloidaler Lösungen haben eine geringe Größe, die ihre durch die Schwerkraft vermittelte Sedimentation schwierig macht. Darüber hinaus bewegen sich die Partikel ständig in einer zufälligen Bewegung und kollidieren miteinander, was es ihnen auch schwer macht, sich abzusetzen. Diese Art der Bewegung ist als Brownian bekannt.
Kolloidale Lösungen haben aufgrund der relativ großen Größe der Partikel der dispergierten Phase ein trübes oder sogar undurchsichtiges Aussehen. Dies liegt daran, dass Licht gestreut wird, wenn es durch das Kolloid tritt, ein Phänomen, das als Tyndall-Effekt bekannt ist..
Heterogenität
Kolloidale Systeme sind inhomogene Systeme, da die dispergierte Phase aus Partikeln mit einem Durchmesser zwischen 10 besteht-9 m und 10-6 m. Inzwischen sind die Partikel der Lösungen kleiner, im allgemeinen weniger als 10-9 m.
Partikel aus der dispergierten Phase kolloidaler Lösungen können das Filterpapier und den Tonfilter passieren. Sie können jedoch keine Dialysemembranen wie Cellophan, Kapillarendothel und Kollodium passieren..
In einigen Fällen sind die Partikel, aus denen die dispergierte Phase besteht, Proteine. In der wässrigen Phase falten sich die Proteine und lassen den hydrophilen Teil nach außen, um eine stärkere Wechselwirkung mit Wasser, durch Ionen-Dipolo-Kräfte oder durch Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen zu erreichen..
Proteine bilden innerhalb der Zellen ein retikuläres System, das einen Teil des Dispergiermittels binden kann. Darüber hinaus dient die Oberfläche der Proteine dazu, kleine Moleküle zu binden, die eine oberflächliche elektrische Ladung erzeugen, die die Wechselwirkung zwischen den Proteinmolekülen begrenzt und verhindert, dass sie Gerinnsel bilden, die ihre Sedimentation verursachen..
Stabilität
Kolloide werden nach der Anziehungskraft zwischen der dispergierten Phase und der Dispergiermittelphase klassifiziert. Wenn die Dispergierphase flüssig ist, werden kolloidale Systeme als Sole klassifiziert. Diese sind in lyophil und lyophob unterteilt.
Lyophile Kolloide können echte Lösungen bilden und sind thermodynamisch stabil. Andererseits können lyophobe Kolloide zwei Phasen bilden, da sie instabil sind; aber aus kinetischer Sicht stabil. Dies ermöglicht es ihnen, lange Zeit in einem verteilten Zustand zu bleiben..
Beispiele
Sowohl die dispergierende Phase als auch die dispergierte Phase können in den drei physikalischen Zuständen der Materie auftreten, dh fest, flüssig oder gasförmig..
Normalerweise befindet sich die kontinuierliche oder dispergierende Phase im flüssigen Zustand, es können jedoch Kolloide gefunden werden, deren Komponenten sich in anderen Aggregatzuständen der Materie befinden..
Die Möglichkeiten, die Dispergierphase und die dispergierte Phase in diesen physikalischen Zuständen zu kombinieren, sind neun.
Jedes wird mit einigen entsprechenden Beispielen erklärt.
Feste Lösungen
Wenn die Dispergierphase fest ist, kann sie sich mit einer dispergierten Phase im festen Zustand verbinden und sogenannte feste Lösungen bilden..
Beispiele für diese Wechselwirkungen sind: viele Stahllegierungen mit anderen Metallen, einige farbige Edelsteine, verstärkter Gummi, Porzellan und pigmentierte Kunststoffe..
Feste Emulsionen
Die Festkörperdispergiermittelphase kann mit einer flüssigdispergierten Phase kombiniert werden, wobei sogenannte feste Emulsionen gebildet werden. Beispiele für diese Wechselwirkungen sind: Käse, Butter und Gelee.
Feste Schäume
Die Dispergierphase als Feststoff kann mit einer dispergierten Phase im gasförmigen Zustand kombiniert werden, die die sogenannten festen Schäume bildet. Beispiele für diese Wechselwirkungen sind: Schwamm, Gummi, Bimsstein und Schaumgummi..
Sonnen und Gele
Die Dispergierphase im flüssigen Zustand verbindet sich mit der dispergierten Phase im festen Zustand und bildet die Sole und die Gele. Beispiele für diese Wechselwirkungen sind: Magnesia-Milch, Farben, Schlamm und Pudding..
Emulsionen
Die Dispergierphase im flüssigen Zustand verbindet sich mit der dispergierten Phase auch im flüssigen Zustand und erzeugt sogenannte Emulsionen. Beispiele für diese Wechselwirkungen sind: Milch, Gesichtscreme, Salatdressings und Mayonnaise..
Schäume
Die Dispergierphase im flüssigen Zustand verbindet sich mit der dispergierten Phase im gasförmigen Zustand und bildet Schäume. Beispiele für diese Wechselwirkungen sind: Rasierschaum, Schlagsahne und Bierschaum.
Feste Aerosole
Die Dispergierphase im gasförmigen Zustand verbindet sich mit der dispergierten Phase im festen Zustand, wodurch die sogenannten festen Aerosole entstehen. Beispiele für diese Wechselwirkungen sind: Rauch, Viren, korpuskuläre Materialien in der Luft, Materialien, die von Autoauspuffrohren emittiert werden.
Flüssige Aerosole
Die Dispergierphase im gasförmigen Zustand kann mit der dispergierten Phase im flüssigen Zustand kombiniert werden, die die sogenannten flüssigen Aerosole bildet. Beispiele für diese Wechselwirkungen sind: Nebel, Nebel und Tau.
Wahre Lösungen
Die Dispergierphase im gasförmigen Zustand kann mit der gasförmigen Phase im gasförmigen Zustand kombiniert werden, wobei die gasförmigen Gemische gebildet werden, die echte Lösungen und keine kolloidalen Systeme sind. Beispiele für diese Wechselwirkungen sind: Luft und Gas aus der Beleuchtung.
Verweise
- Whitten, Davis, Peck & Stanley. Chemie. (8. Aufl.). CENGAGE Lernen.
- Toppr. (s.f.). Klassifikation von Kolloiden. Wiederhergestellt von: toppr.com
- Jiménez Vargas, J und Macarulla. J. M. (1984). Physiologische Physikochemie, 6. Auflage. Editorial Interamericana.
- Merriam-Webster. (2018). Medizinische Definition der dispergierten Phase. Wiederhergestellt von: merriam-webster.com
- Madhusha. (2017, 15. November). Unterschied zwischen dispergierter Phase und Dispersionsmedium. Wiederhergestellt von: pediaa.com

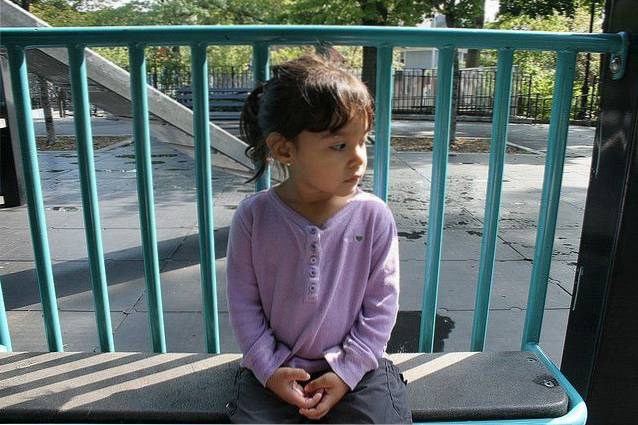

Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.